Man
unterscheidetdrei
Geldmengenbegriffe. Die Entwicklung der Geldmenge wird von
der Europäischen Zentralbank
monatlichveröffentlicht.
International haben
sich folgende Geldmengen-Abgrenzungen durchgesetzt:
-
Geldmenge
M1, bestehend aus
dem Bargeldumlauf und den Sichtguthaben bei den
Kreditinstituten;
-
Geldmenge
M2, bestehend aus
M1 zuzüglich der Termineinlagen bei Kreditinstituten mit einer
Befristung unter vier Jahren;
-
Geldmenge
M3, bestehend aus
M2 zuzüglich der Spareinlagen mit gesetzlicher
Kündigungsfrist.
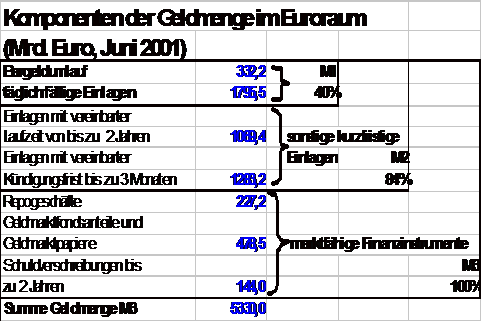
Von der Deutschen
Bundesbank wurde früher im voraus für das jeweils neue
Jahr eine Größe bekannt gegeben, um die sich die
Geldmenge (M3) ausweiten sollte. Die Regulierung der
Geldmenge ist insofern von Bedeutung, als sie dazu
beiträgt, die von Regierung und Zentralbank erwünschten
volkswirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Hierzu gehören unter
anderem Preisstabilität, Wirtschaftswachstum sowie ein
Höchstmaß an Beschäftigung.
Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht kein
explizites Geldmengenziel, sondern gibt lediglich
einenReferenzwert für das von ihr als angemessen erachtete
Wachstum der Geldmenge M3 bekannt. Dieser liegt derzeit
bei4,5%. Die Ableitung dieses Referenzwertes erfolgt aber
nach den gleichen Regeln wie früher die Ableitung des
Geldmengenziels der Deutschen Bundesbank. Die Geldmengenentwicklung
spielt innerhalb der geldpolitischen Strategie der EZB eine
wichtige Rolle. Über- oder Unterschreitungen des
Referenzwertes werden als Indikatoren für geldpolitischen
Handlungsbedarf angesehen.
Derzeit (28.06.04)
beschleunigt sich das Geldmengenwachstum. Es lag im Februar
2003 bei 3,25% und im Mai 2004 bei 4,7%. Der Referenzwert
ist somit überschritten. Ein starkes Geldmengenwachstum
erhöht im Allgemeinen die Inflationsgefahr, was für die
EZB üblicherweise ein Grund wäre, eine Zinserhöhung
vorzunehmen. Da mit dem Geld infolge der Konjunkturschwäche
derzeit jedoch keine Waren oder Dienstleistungen nachgefragt
wurden, droht aktuell keine Inflation.
Steigt die Geldmenge
stärker als vorgesehen, greift die EZB ein um das Geld zu
verknappen. Ziel ist es dabei, Einfluss auf die
Geschäftsbanken zu nehmen und deren Liquidität zu
drosseln.
Seit 1999 hat die
EZB die Möglichkeit die Geldmenge durch
Leitzinsfestsetzung zu beeinflussen. Sie kann dazu
-
die Geldmenge begrenzen
(restriktive
Geldpolitik)
oder
-
die Geldmenge ausweiten
(expansive
Geldpolitik).
In der Rezession
wird die EZB die Zinsen senken und damit die Liquidität
und somit die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken
erhöhen.
Durchsinkende Zinsen
sollen die Unternehmen und Haushalte mehr Kredite aufnehmen und
damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigern. Dadurch steigt
die Produktion und die Beschäftigung und........
Allerdings steigt
auch die Inflationsgefahr.
Die Politik des
billigen Geldes soll allerdings nicht so aussehen:
|
Sieht es so hinter
den belgischen Geldautomaten aus?
|
«Bitte
nehmen Sie die Scheine aus dem Drucker.»
Deutschsprachige Aufforderung an belgischen
Geldautomaten.)
|
-
Die EZB ist verantwortlich für
die Geldpolitik im Europäischen Währungssystem
EWS.
-
Hauptaufgabe der EZB ist die
Sicherung der Geldwertstabilität.
-
Der Rat der EZB beschließt
über den Einsatz der geld- und kreditpolitischen Instrumente,
die im Bundesbankgesetzfestgelegt sind.
-
Mit ihrer Geldpolitik beeinflusst
die EZB die Geldmenge.
-
Die Kreditvergabe unterliegt in
unserer Marktwirtschaft den Gesetzen von Angebot und
Nachfrage.
-
Weiten die Kreditinstitute ihr
Angebot an Krediten aus, wird der Preis dafür - wir sprechen
vom Zins - sinken. Umgekehrt werden die Kreditzinsen steigen, wenn
sich das Kreditangebot verknappt.
|
In einer
konjunkturellen Boomphase mit hohen Inflationsraten geht die
EZB den umgekehrten Weg: Sie versucht die Zinsen zu erhöhen
und mit einer Politik des knappen Geldes die Geldmenge zu
begrenzen. Die Refinanzierung der Geschäftsbanken bei der
Zentralbank verteuert sich. Dadurch können weniger Kredite
vergeben werden. Die Banken geben dann die höheren Zinsen an
die Kunden weiter um Gewinneinbußen zu vermeiden. Die Kredite
werden teuerer.
Dadurch werden
weniger Kredite aufgenommen. Dadurch wird die Geldmenge
begrenzt. Die Investitionen werden reduziert. Die Nachfrage
sinkt. Das Preisniveau stabilisiert sich wieder.
Sinkender Konsum und
sinkende Investitionen kosten allerdings auch
Arbeitsplätze.
Die Geldmengensteuerung der EZB erfolgt durch
drei Instrumente:

