Das Europäische
Parlament (EP) mit
Sitz im Straßburg hat 732 Abgeordnete, davon
99 aus Deutschland. Das Parlament vertritt derzeit 455 Millionen
EU-Bürger in 25 Mitgliedsstaaten. Die Abgeordneten
schließen sich in übernationale Fraktionen zusammen, die
nicht nach ihrem Herkunftsland sondern nach ihrer
Fraktionszugehörigkeit vereint im Plenarsaal sitzen. Das EP
wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und 14
Vizepräsidenten für eine halbe
Wahlperiode.
Zwölf Wochen
pro Jahr finden Plenarsitzungen statt. In der Zwischenzeit tagen
die
24 ständigen Ausschüsse und Fraktionen in Brüssel, um einen
fortwährenden Kontakt zur Kommission und zum Rat zu
ermöglichen. Es unterhält ein Generalsekretariat in
Brüssel und Informationsbüros in den Hauptstädten
der Mitgliedsstaaten. Das EP wird alle fünf Jahre
gewählt, das nächste Mal am 2014.
Die Bedeutung des EP
ist durch mehrere Vertragsänderungen in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen. Es muss immer mehr Beschlüssen des
Ministerrates zustimmen, bevor diese in Kraft treten können.
In der Praxis hat dies dazu geführt, dass Vertreter des
Parlaments frühzeitig an der Entscheidungsfindung beteiligt
werden.
Im Wesentlichen gibt
es in der Union vier verschiedene Verfahren zur
Gesetzgebung:
Erster Schritt ist immer ein Vorschlag
(Gesetzentwurf) der EK, der von Rat und Parlament angefordert
werden kann.
-
Im Mitentscheidungsverfahren, das
für etwa aller Beschlüsse der EU gilt,
sind Ministerrat
und Parlament gleich berechtigt an der Gesetzgebung beteiligt. Der
Vorschlag geht zur ersten Lesung ins Parlament, das eine
Stellungnahme abgibt, und zum Rat, der einen Gemeinsamen Standpunkt
beschließt. In der zweiten Lesung kann das EP den Gemeinsamen
Standpunkt billigen, mit der absoluten Mehrheit ablehnen oder
abändern. Der Rat kann nun alle Änderungen des EP mit
qualifizierter Mehrheit bzw. einstimmig billigen, wenn die
Kommission die Änderungen abgelehnt hat. Billigt der Rat die
Änderungsvorschläge nicht, kann ein Vermittlungsausschuss
binnen sechs Wochen einen Kompromiss aushandeln. Wird ein
Gemeinsamer Entwurf gefunden, müssen Parlament und Rat ihm in
der dritten Lesung zustimmen, damit er zum Rechtsakt wird (Art. 251
EG).
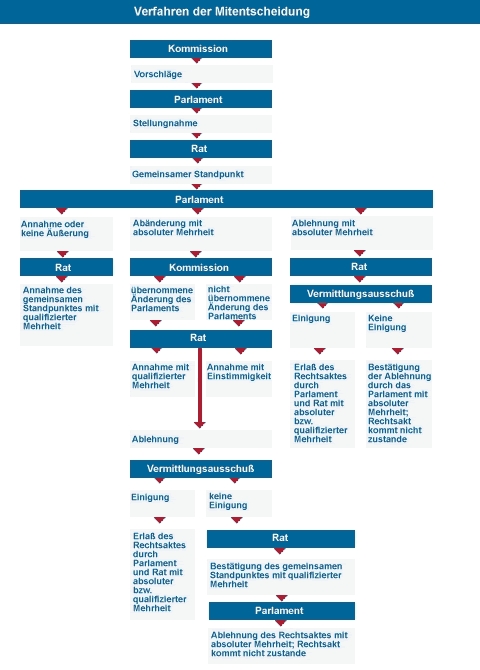
-
Im Zusammenarbeitsverfahren kann
das Parlament Änderungen nur vorschlagen, jedoch nicht
durchsetzen, sofern der Rat die Änderungen einstimmig ablehnt.
Dieses Verfahren wird ausschließlich in der Wirtschaftspolitik
angewendet (Art. 252 EG).
-
Im dem
älteren Anhörungsverfahren (Agrarpolitik)
hat das Parlament nur eine beratende Funktion.
-
Das Zustimmungsverfahren wird bei
Verträgen zum Beitritt oder zur Assoziierung weiterer Staaten
bei Schaffung neuer Strukturfonds, bei Übertragung von
Aufgaben an die Europäische Zentralbank (EZB), bei Ernennung
der Kommission und des Kommissionspräsidenten sowie bei der
Verhängung von Sanktionen an Mitgliedsländer mit der
absoluten Mehrheit angewendet.
Mit
dem Budgetrecht hat das EP die Befugnis,
den jährlichen Haushaltsplan als Gesetz zu verabschieden. Das
EP und der Rat sind für Beratung und Feststellung des
Haushalts der Union zuständig (Haushaltsbehörde). Bei
allen Ausgaben, die sich nicht direkt oder indirekt aus
Vorschriften der EU-Verträge ergeben (nichtobligatorische
Ausgaben), hat das EP das letzte Wort in Höhe und Verteilung.
Das sind in etwa die Hälfte der Gesamtausgaben und damit
für die Weiterentwicklung der EU besonders wichtige: Sozial-
und Regionalpolitik, Forschung, Umwelt etc. Bei den obligatorischen
Ausgaben kann das Parlament Änderungen vorschlagen.
Möglich ist auch, den Haushaltsentwurf insgesamt
abzulehnen.
Etwas weniger als
die Hälfte der Eigenmittel der EU wird
für die gemeinsame Agrarpolitik ausgegeben,
ein weiteres Drittel gilt der Förderung benachteiligter
Regionen.
Eine
zusätzliche wichtige Aufgabe des EP ist es,
seine Kontrollrechte Rat und Kommission
gegenüber auszuüben. Es muss der Ernennung einer neuen
Kommission und ihres Präsidenten zustimmen; mit der Mehrheit
der Abgeordneten kann sie einem amtierenden Kommissar das Vertrauen
entziehen bzw. mit der Zweidrittelmehrheit eines Misstrauensvotums
die ganze Kommission zum Rücktritt zwingen.
Außerdem muss
am Anfang einer Ratspräsidentschaft ein Arbeitsprogramm und am
Ende ein Rechenschaftsbericht vor dem Parlament abgelegt werden,
ebenso bei Gipfeltreffen. Weitere Kontrollmöglichkeiten des EP
sind monatliche Fragestunden bei Rat und Kommission, Debatten
über den Gesamtbericht der Kommission und die Einsetzung von
Untersuchungsausschüssen bei Verdacht auf Verstöße
gegen das Gemeinschaftsrecht. Auch die EZB muss einen
Rechenschaftsbericht ablegen und vor den Parlamentsausschüssen
Rede und Antwort stehen. Bei Fragen zur Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) kann das EP Stellungnahmen abgeben, die
vom Rat berücksichtigt werden müssen. Das EP soll eine
unabhängige Kammer sein, die vor allem den Interessen der
Bürger verpflichtet ist.
In der EU gibt es
ca. 342 Mio. Wahlberechtigte, jedoch hat die
Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament zuletzt
auf 43,0 % (1999: 45,2 %) abgenommen. Dies
zeigt das mangelnde Interesse seitens der
Bevölkerung, auf das politische Geschehen in der EU
Einfluss zu nehmen. Einige Gründe spielen dabei eine Rolle:
Die Politiker unternehmen nicht ausreichend Bemühungen, ihre
Wähler genügend zu informieren und einzubinden; auch in
den Medien sind Europa- Themen untergewichtet. So kommt es, dass
sich viele nicht direkt von der EU- Politik betroffen fühlen
und diese als bürgerfern empfinden. Aufgrund der geringen
Wahlbeteiligung lässt sich hinterfragen, wie weit die EU durch
die Bürger demokratisch legitimiert ist. Für die Zukunft
wird es wichtig sein, dass dem EP als einzig direkt gewähltem
Organ auf EU-Ebene noch mehr Entscheidungsgewalt und Kompetenzen
übertragen werden. Gefordert wird die Ausdehnung des
Mitentscheidungsverfahren auf alle Politikbereiche; die
Außen-, Sicherheits-, Innen- und Justizpolitik sollen
vergemeinschaftet werden. Ziel wäre ein einheitliches
europäisches Wahlverfahren und die Benennung des
Kommissionspräsidenten durch das EP. Dies wirft wiederum die
Frage auf, ob die angestrebte politische Einigung Europas in einem
Bundesstaat mit eigener Verfassung münden
soll.
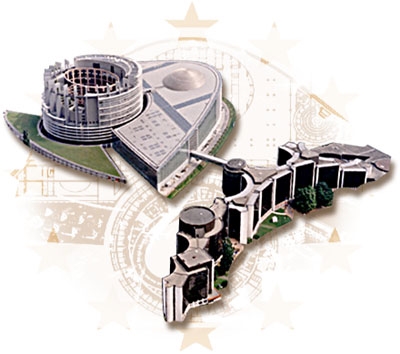
Die Rechtsakte der
EU-Organe:
-
Verordnungen sind in der
gesamten EU gültige und verbindliche Gesetze, die über
dem nationalen Recht stehen.
-
Richtlinien sind
Weisungen an die EU-Staaten, nationale Gesetze oder Vorschriften zu
ändern oder neu zu erlassen, um ein verbindlich vorgegebenes
Ziel zu erreichen (Art. 249 EG). Ein großer Teil der in
Deutschland erlassenen Gesetze beruht auf der Umsetzung von
EU-Richtlinien. Für die Bevölkerung ist es somit meist
schwer erkennbar, wie viel Einfluss die Europäische Union
gerade auf nationale Gesetze hat.
-
Entscheidungen sind
Rechtsakte, die Einzelfälle verbindlich
regeln.

